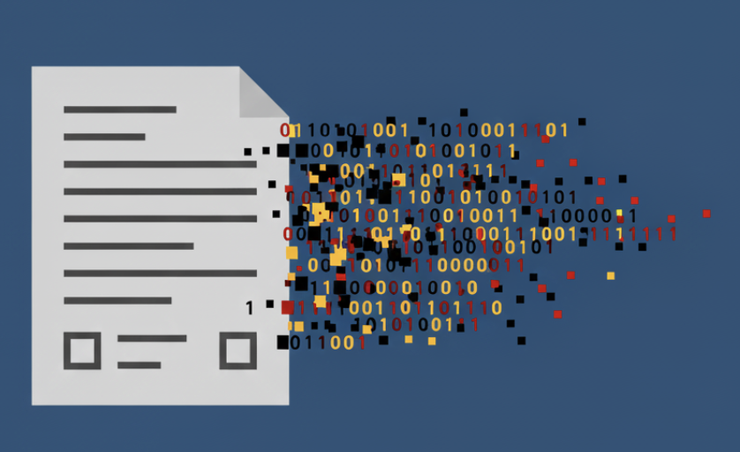
Alle reden über eGovernment – doch kaum jemand glaubt, dass wir mit der Verwaltungsdigitalisierung wirklich voran gekommen sind. Zu oft blieb es beim „Papier-ins-PDF“. Während Länder wie
Estland oder Dänemark Prozesse neu denken (Digitization), kämpft Deutschland noch mit Formularen und Medienbrüchen. Aber hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich gar nichts getan? Der Blick
in den Behördenalltag zeigt: Es gibt spürbaren Fortschritt – nur anders verteilt und weniger einheitlich als erhofft …
Sebastian Büttner
Fragt man Bürgerinnen und Bürger nach eGovernment in Deutschland, hört
man oft: „Das funktioniert doch sowieso nicht.“ Und tatsächlich: Wer Elterngeld beantragt, den Führerschein ersetzt oder ein Auto ummeldet, erlebt häufig eine halb-digitale Verwaltung –
irgendwo zwischen Online-Formular, PDF-Upload und doch noch einem Gang zum Amt. Denn in Deutschland wurden – zumindest zu Beginn der Digitalisierung – analoge Abläufe häufig nur digital
nachgebaut – sprich: „Papier ins PDF“. Andere Länder haben Verwaltungsprozesse dagegen haben die Digitalisierung als Chance genutzt, ihre Prozesse völlig neu zu gestalten:
Unternehmensgründung in 30 Minuten, Kindergeld ohne Antrag, Steuer per SMS bestätigt …
Doch wie sieht es heute aus – anno 2025? Wo steht Deutschland gerade? Immer noch im "PDF-Zeitalter" – einen Wimpernschlag nach der Erfindung der Schreibmaschine? Oder gibt es uns
vielleicht doch weitaus mehr Leuchttürme der wirklichen Digitization als wir glauben?
Vor diesem Hintergrund haben wir uns einmal genauer umgeschaut und sieben Beispiele aus der Praxis zusammengestellt, die aufzeigen wo wir gerade wirklich stehen und was in
Zukunft genau geplant ist …
1. Ein Besuch beim Bürgeramt
Vor 10 Jahren (2015): Wohnsitz anmelden bedeutete: Termin am Telefon suchen, halben Arbeitstag frei nehmen, Formulare handschriftlich
ausfüllen.
Heute (2025): Online-Termin, digitale Formulare, Meldebescheinigung als PDF – in vielen Städten möglich. Aber: Die eigentliche
Wohnsitzanmeldung oder -ummeldung ist meist noch nicht vollständig digital möglich. Oft muss man – trotz Online-Termin und vorausgefüllter Formulare – noch einmal persönlich
erscheinen, weil Unterschriften oder Identitätsnachweise im Original verlangt werden.
Fazit: Viele kleine Fortschritte seit 2015, aber immer noch eine Dauer-Baustelle und zu uneinheitlich. Das Ziel muss sein: flächendeckende Standardisierung – und völlige Digitization.
Wie es andere Länder machen: In Dänemark läuft eine Adressänderung komplett digital und ist mit allen Behörden automatisch
verknüpft – vom Steueramt bis zur Krankenversicherung.
2. Auto an- und abmelden
Vor 10 Jahren: Stundenlange Wartezeiten in der Zulassungsstelle, mehrere Gänge zum Schalter.
Heute: Die App i-Kfz ermöglicht Abmeldungen online, Anmeldungen vielerorts ebenfalls.
Fazit: Eine der sichtbarsten Verbesserungen. Doch es gibt immer noch einige unnötige Medienbrüche:
- Kennzeichen müssen nach wie vor physisch geprägt und gesiegelt werden.
- Manche Nachweise (z. B. Vollmacht, Sondergenehmigungen) sind weiterhin nur auf Papier anerkannt.
- Gebührenzahlung erfolgt teils über externe Bezahlsysteme statt integriert.
- Fahrzeug- und Halterdaten müssen in vielen Kommunen manuell eingegeben werden, statt automatisch aus Registern zu fließen.
Und es gibt da noch das Problem der Einheitlichkeit:
-
Kfz-Zulassung ist zwar Bundesrecht, die IT-Umsetzung liegt aber bei Kommunen und Ländern.
-
Technische Unterschiede in Fachverfahren sorgen für unterschiedliche Ausbaustufen.
-
Einige Kommunen haben die letzte i-Kfz-Stufe (digitale Neuzulassung seit 2023 möglich) noch nicht umgesetzt.
-
Sonderfälle (Importfahrzeuge, Oldtimer) erfordern oft weiterhin persönliche Vorsprache.
Wie es andere Länder machen: In Estland werden Fahrzeuge direkt über das digitale Bürgerkonto an- und abgemeldet. Der Vorgang dauert meist weniger als zehn Minuten.
3. Führerschein vorzeigen
Vor 10 Jahren (2015): Der Führerschein war ein Dokument aus Plastik oder Papier. Wer ihn verlor, musste persönlich zur Führerscheinstelle, Passfoto und Meldebescheinigung mitbringen und mehrere Wochen auf den Ersatz warten. Unterwegs hatte man nur das physische Kärtchen in der Brieftasche – keine Alternative.
Heute (2025): Seit 2021 gibt es den digitalen Führerschein als App (in der „ID Wallet“ oder über EU-Pilotprojekte). Er speichert Führerscheindaten auf dem Smartphone
und kann bei Kontrollen vorgezeigt werden.
Allerdings: Nicht alle Polizeidienststellen sind technisch darauf eingestellt. Auch im Ausland stößt der digitale Nachweis häufig an seine Grenzen, sodass Autofahrer vorsichtshalber die
Plastikkarte dabeihaben. Zumal es noch an einer verbindlichen EU-weiten technischen Norm gibt, die eine einheitliche Anerkennung sicherstellen kann. Dazu gibt es noch einige Medienbrüche:
-
Parallelnutzung: Bürger brauchen sowohl die digitale App als auch weiterhin die Plastikkarte.
-
Akzeptanzlücken: In vielen Polizeibehörden fehlen Scanner oder Schnittstellen – Beamte können die digitale Version nicht prüfen.
-
Antragstellung: Ersatzführerschein oder Erstausstellung laufen nach wie vor über physische Unterlagen und persönliche Vorsprache.
-
Auslandsnutzung: Andere Länder erkennen den deutschen digitalen Führerschein nicht an.
Fazit: Der digitale Führerschein ist ein symbolträchtiges Projekt der Verwaltungsdigitalisierung – er zeigt, dass Behörden digitale Identitätsnachweise ernst nehmen. Praktisch bleibt er aber eingeschränkt, solange Bürger beide Versionen mitführen müssen und die internationale Anerkennung fehlt.
Wie es andere Länder machen: In Finnland ist der digitale Führerschein nicht nur eingeführt, sondern bereits grenzüberschreitend
erprobt. Autofahrer können ihn in vielen Nachbarländern nutzen – ein Beispiel, wie europäische Interoperabilität funktionieren kann.
4. Steuererklärung abgeben
Vor 10 Jahren (2015): Die jährliche Steuererklärung war für viele ein Papiermarathon. Bürger füllten Formulare am PC oder sogar noch von Hand
aus, druckten seitenweise Unterlagen, unterschrieben alles und brachten es persönlich zum Finanzamt oder schickten es per Post. Rückmeldungen, Nachfragen oder Bescheide kamen Wochen später –
natürlich ebenfalls auf Papier.
Heute (2025): Mit ELSTER ist die elektronische Abgabe Standard geworden: Rund 25 Millionen Steuerpflichtige reichen ihre Erklärung jährlich online ein. Bescheide können digital abgerufen, Nachfragen elektronisch beantwortet und Belege hochgeladen werden. Für Millionen Menschen ist der Papierweg längst Geschichte. Aber auch hier gibt es leider immer noch Medienbrüche:
-
Belegpflichten: Manche Nachweise (z. B. bei Sonderausgaben, Pflegekosten) müssen noch im Original nachgereicht werden, wenn das Finanzamt sie anfordert.
-
Parallelsysteme: Neben ELSTER gibt es Drittanbieter-Software – hilfreich für Laien, aber das zeigt, dass die staatliche Lösung oft als zu kompliziert empfunden wird.
-
Uneinheitliche Nutzung: Manche Finanzämter kommunizieren bereits digital über ELSTER-Postfächer, andere verschicken weiterhin klassische Briefe.
-
Identitätsprüfung: Registrierung bei ELSTER ist aufwendig (Zertifikatsdateien, Sicherheitsverfahren), und mobile Nutzung ist eingeschränkt.
Warum nicht bundesweit einheitlich?
-
ELSTER ist zwar ein zentrales System, wird aber von den Ländern betrieben. Unterschiedliche Finanzämter nutzen digitale Kanäle unterschiedlich intensiv.
-
Gesetzliche Vorgaben sind teilweise komplex: Manche Daten dürfen nicht automatisch aus anderen Registern übernommen werden, obwohl sie längst vorliegen (z. B. Versicherungs- oder Rentendaten).
-
Bürgerfreundliche Features wie vorausgefüllte Erklärungen sind technisch vorhanden, aber noch nicht flächendeckend aktiv.
Fazit: Die Steuererklärung ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Millionen Menschen nutzen
sie bereits digital. Doch das System ist kompliziert, nicht konsequent nutzerzentriert und mobil eingeschränkt. To-do: Radikale Vereinfachung, stärkere
Automatisierung und echte Mobile-First-Lösungen.
Wie es andere Länder machen: In Schweden erhalten Bürger vorausgefüllte Steuererklärungen – sämtliche Daten kommen automatisch aus Registern. Wer keine Änderungen hat, bestätigt einfach per SMS. Der Unterschied: Statt Bürger Daten sammeln zu lassen, übernimmt der Staat die Vorarbeit.
5. Kindergeld und Elterngeld
Vor 10 Jahren (2015): Wer ein Kind bekam, musste sich auf einen echten Bürokratie-Marathon einstellen. Für Kindergeld und Elterngeld waren mehrere, seitenlange Papierformulare auszufüllen, Ausweise und Geburtsurkunden in Kopie beizulegen und alles per Post einzuschicken oder persönlich bei der Familienkasse abzugeben. Rückfragen oder fehlende Belege führten zu Verzögerungen – und die Bearbeitung konnte Wochen bis Monate dauern.
Heute (2025): Die Antragstellung ist in vielen Regionen digitalisiert: Eltern können Anträge online ausfüllen, Nachweise hochladen und den Bearbeitungsstatus im Portal
nachverfolgen. Mit der BundID ist ein zentraler Login möglich, der die Identifikation erleichtert. Besonders
spürbar ist das bei Familien, die sonst mit Stapeln an Formularen und Kopien jonglieren mussten. Dazu gibt es noch einige Medienbrüche:
-
Belege: Viele Nachweise (z. B. Geburtsurkunde, Einkommensnachweise) müssen noch eingescannt und hochgeladen werden, statt direkt digital aus Registern übernommen zu werden.
-
Parallelwege: Manche Familienkassen bestehen trotz Online-Formular zusätzlich auf einem unterschriebenen Papierexemplar.
-
Regionale Unterschiede: Während in einigen Bundesländern komplette digitale Verfahren möglich sind, setzen andere noch stark auf Papier.
-
Kommunikation: Zwischen Antragstellern und Familienkassen läuft die Korrespondenz oft noch per Briefpost, auch wenn der Antrag online gestellt wurde.
Fazit: Die Digitalisierung von Kindergeld- und Elterngeldanträgen ist ein großer Fortschritt: Eltern sparen Zeit und Aufwand. Aber solange Daten nicht automatisiert zwischen Behörden fließen und Verfahren regional unterschiedlich sind, bleibt der Prozess zu kompliziert und zu langsam. Ziel: ein deutschlandweit einheitliches, vollautomatisiertes Familienportal.
Wie es andere Länder machen: In Estland läuft es ganz anders: Dort wird Kindergeld automatisch ausgezahlt, sobald ein Kind im Geburtenregister eingetragen ist. Eltern
müssen keinen Antrag stellen – der Staat nutzt vorhandene Daten und zahlt von selbst. Ein Musterbeispiel für echte Digitization statt nur Digitalisierung.
6. Unternehmen gründen
Vor 10 Jahren (2015): Eine Unternehmensgründung bedeutete Papierstapel und Geduld. Gründer mussten persönlich beim Gewerbeamt erscheinen, Formulare ausfüllen, Kopien von Ausweisen und Nachweisen einreichen und Gebühren bar oder per Überweisung begleichen. Danach ging es oft noch weiter: Eintrag ins Handelsregister, Notartermin, Eröffnung des Geschäftskontos. Jeder Schritt lief separat, viele davon ausschließlich vor Ort und mit analogen Dokumenten.
Heute (2025): Die
digitale Gewerbeanmeldung ist in vielen Regionen bereits möglich. Gründer können Formulare online ausfüllen und Gebühren elektronisch bezahlen. Einige Handelsregister-Einträge sind
digitalisiert, und über die BundID ist die Identifizierung inzwischen für Standardfälle online möglich. Notartermine sind teilweise per Videokonferenz erlaubt. Das spart Zeit – der persönliche
Gang zum Amt entfällt in vielen Städten. Nur leider gibt es auch auf diesem Feld noch zu viele Medienbrüche:
-
Notarielle Beglaubigung: Bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG) ist ein Notartermin nach wie vor Pflicht, teils mit handschriftlicher Unterschrift und physischem Registereintrag.
-
Registerintegration: Gewerbeanmeldung, Handelsregister, Finanzamt und IHK sind nur teilweise miteinander verknüpft – Gründer müssen Daten mehrfach eingeben.
-
Bankprozesse: Geschäftskonten können zwar online eröffnet werden, erfordern aber oft noch zusätzliche Ident-Verfahren (PostIdent oder VideoIdent), die nicht immer mit den Behördensystemen gekoppelt sind.
-
Uneinheitliche Plattformen: Manche Bundesländer bieten digitale Gründerportale, andere nicht – dadurch entsteht ein Flickenteppich.
Fazit: Die Unternehmensgründung ist heute spürbar einfacher als noch vor zehn Jahren. Aber von einem echten digitalen Gründungserlebnis – „alles aus einer Hand, alles in einem Portal“ – ist Deutschland noch weit entfernt. To-do: One-Stop-Shop-Lösungen schaffen, Register automatisch verknüpfen und medienbruchfreie Prozesse einführen.
Wie es andere Länder machen: In Estland dauert eine Unternehmensgründung online rund 30 Minuten. Gründer nutzen ausschließlich ihre digitale ID, und alle Behörden – vom Register bis zum Finanzamt – sind miteinander verknüpft. Kein Papier, kein Notartermin, keine mehrfachen Eingaben.
7. Studieren und BAföG
Vor 10 Jahren (2015): Der BAföG-Antrag war berüchtigt – ein Papier-Albtraum. Jedes Jahr mussten Studierende und ihre Eltern stapelweise Formulare ausfüllen: Angaben zu Einkommen, Vermögen, Miete, Studium. Dazu kamen Kopien von Steuerbescheiden, Mietverträgen und Immatrikulationsbescheinigungen. Alles musste per Post an das zuständige Amt geschickt werden. Fehler oder fehlende Unterlagen führten zu Rückfragen per Brief – was die Bearbeitung weiter verzögerte.
Heute (2025): Mit der Einführung von digitalen BAföG-Portalen ist vieles einfacher geworden. Studierende können die Anträge online ausfüllen, Nachweise hochladen und den Status ihres Antrags nachverfolgen. Der Login über die BundID erleichtert die Identifizierung und ermöglicht es, dass zentrale Daten (z. B. persönliche Angaben) automatisch vorausgefüllt werden. Manche Ämter kommunizieren inzwischen direkt über das Portal, sodass Rückfragen schneller beantwortet werden können. Trotzdem finden sich auch hier immer noch unnötige Medienbrüche:
-
Nachweise: Viele Belege (z. B. Einkommen der Eltern, Steuerbescheide) müssen nach wie vor eingescannt und hochgeladen werden, statt automatisch aus Registern übernommen zu werden.
-
Parallele Kommunikation: Manche Ämter bestehen weiterhin auf postalischer Nachreichung oder senden Bescheide ausschließlich per Brief.
-
Unterschiedliche Plattformen: Es gibt mehrere Portallösungen je nach Bundesland; nicht alle sind gleich weit entwickelt.
-
Wiederholungsanträge: Studierende müssen viele Angaben jedes Jahr erneut eingeben, statt dass das System Daten automatisch übernimmt.
Warum nicht bundesweit einheitlich?
-
Föderale Zuständigkeiten: BAföG wird von den Ländern verwaltet. Jedes Bundesland betreibt eigene Systeme, wodurch ein Flickenteppich an Lösungen entstanden ist.
-
Fehlende Datenintegration: Steuer- und Sozialdaten liegen zwar digital vor, dürfen aber noch nicht automatisiert ins BAföG-Verfahren übernommen werden.
-
Technische Fragmentierung: Unterschiedliche IT-Systeme erschweren die Umsetzung einer gemeinsamen Plattform.
Fazit: Das BAföG-Verfahren ist deutlich digitaler als vor zehn Jahren – ein klarer Fortschritt für Studierende. Doch solange Daten nicht automatisch aus Registern übernommen werden und Bundesländer mit eigenen Portalen arbeiten, bleibt der Antrag zu aufwendig. To-do: einheitliches BAföG-Portal und konsequente Automatisierung von Wiederholungsanträgen.
Wie es andere Länder machen: In den Niederlanden ist die Studienfinanzierung direkt mit der Steuer-ID verknüpft.
Studierende beantragen ihre Förderung online, und Einkommensdaten der Eltern werden automatisch aus der Steuerverwaltung übernommen. Damit entfällt das Nachreichen von Belegen fast vollständig –
ein deutlicher Unterschied zu Deutschland.
Gesamtfazit: Mehr erreicht, als viele glauben – aber noch viel zu tun
Die letzten zehn Jahre Verwaltungsdigitalisierung zeigen ein gemischtes Bild: spürbare Verbesserungen im Alltag (ELSTER, i-Kfz, Online-Termine, digitale Familienleistungen) stehen neben Medienbrüchen und föderaler Uneinheitlichkeit. Für viele Bürger ist das Ergebnis: „Es ist besser geworden — aber nicht verlässlich genug.“
Wo wir heute stehen:
-
Inseln des Fortschritts: Steuer digital, Kfz teils digital, BAföG/Kindergeld vielerorts online, BundID im Alltag angekommen.
-
Bruchkanten: Original-Nachweise, parallele Papierwege, mehrfaches Dateneingeben, uneinheitliche Portale und Prozesse.
-
Wahrnehmung: Nutzen spürbar, aber nicht konsistent — dadurch bleibt Skepsis.
Alle Hoffnungen ruhen nun auf dem Onlinezugangsgesetz (OZG) und seiner Weiterentwicklung im OZG 2.0. Das ursprüngliche OZG von 2017 hatte den großen Anspruch, 575 Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital verfügbar zu machen. Es führte Prinzipien wie das „Once Only“ – Daten sollen Bürger nur einmal angeben müssen – und die Einführung eines bundesweiten Nutzerkontos ein. Auch wenn die gesetzte Frist klar verfehlt wurde, hat das Gesetz die Diskussion beschleunigt und die Digitalisierung der Verwaltung erstmals verbindlich auf die politische Agenda gesetzt.
Mit dem OZG 2.0, das seit 2024 gilt, zieht die Verwaltung nun die Schrauben an. Zum ersten Mal wird ein Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen verankert, der ab Juli 2028 greifen soll
– ein echter Game Changer, wenn er konsequent umgesetzt wird. Darüber hinaus verpflichtet das Gesetz die Behörden, ihre Dienste benutzerfreundlich, barrierefrei und durchgängig zu gestalten. Die
BundID wird als Standard-Login gestärkt, um den Zugang zu allen digitalen Services einheitlich zu machen. Gleichzeitig sollen Schnittstellen, Datenmodelle und Qualitätskriterien verbindlich
vereinheitlicht werden. Und schließlich soll das „Once Only“-Prinzip nun endlich auch praktisch Realität werden: Statt Belege von Bürgern einzufordern, müssen die Behörden vorhandene Register
verknüpfen und Daten automatisiert abrufen.
Damit zeigt sich: Deutschland hat zwar mehr erreicht, als viele wahrnehmen – von ELSTER über i-Kfz bis zu digitalen Familienleistungen. Doch der Weg von der Insel-Digitalisierung hin zu einem wirklich durchgängigen eGovernment-Erlebnis ist noch weit. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Vorgaben des OZG 2.0 nicht nur auf dem Papier umzusetzen, sondern in den Alltag der Menschen zu bringen. Erst dann wird der Gang zum Amt endgültig zu einem Relikt der Vergangenheit – und Deutschland kann im internationalen Vergleich wirklich aufholen.
